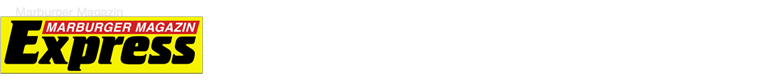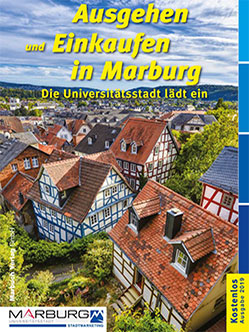Hauptstadt der Wohngemeinschaften
 In Marburg leben knapp 50 Prozent der Hochschüler in einer WG –
In Marburg leben knapp 50 Prozent der Hochschüler in einer WG –
Foto: Wegst
"Männerfreie Zone" verspricht die WG-Tür. Wer das gelbe Schild aufgehängt hat, weiß Soziologiestudentin Margarita Kotseva nicht mehr so genau. Es wohnen jedenfalls nur Frauen in der 5er-WG im zweiten Stock des Adolf-Reichwein-Hauses im Marburger Studentendorf. Mit strahlendem Lächeln stellt sie ihre Mitbewohnerinnen vor: Zwei Deutsche, eine Chinesin und eine Pakistanerin. Sie selbst kommt aus einer bulgarischen Kleinstadt. Das Studentenwerk hat sie aus allen Ecken der Welt zusammengewürfelt. Jetzt können sie sich kaum noch vorstellen, allein zu wohnen. "Es ist toll, dass immer jemand zum Reden da ist", sagt Germanistikstudentin Laureen Mieth. "Sie sind für mich wie die Schwestern, die ich nie hatte", sagt Margarita Kotseva. Und sie wohnen außerordentlich günstig: Jede Bewohnerin zahlt 181 Euro warm.
Mit der WG haben sich die fünf Frauen die häufigste Wohnform von Studierenden in Marburg ausgesucht. Nirgendwo in Deutschland gibt es so viele Wohngemeinschaften wie hier. In der Universitätsstadt leben knapp 50 Prozent der Hochschüler in einer WG. Obwohl die Wohngemeinschaften auch in anderen Universitätsstädten immer beliebter werden, liegt ihr Anteil nach der Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks bundesweit bei "nur" 29 Prozent. "Damit sind wir Deutschlands WG-Hauptstadt", sagt der Geschäftsführer des Marburger Studentenwerks, Uwe Grebe.
Die Marburger Vorliebe für Wohngemeinschaften geht nach seiner Überzeugung ursprünglich auf die Studentenbewegung zurück. Damals zogen linke Studierende aus ganz Deutschland ins rote Marburg – vorzugsweise in eine WG. Schließlich gibt es vor allem in den Altbauten viele größere Wohnungen, die sich oft leichter an die weniger anspruchsvollen Studierenden vermieten lassen. Zudem können mehrere WG-Mitglieder oft mehr zahlen als eine Familie. Freilich leben viele Hochschüler auch aus finanziellen Gründen in einer Kommune. Eine eigene Wohnung können sich die meisten nicht leisten.
Das Marburger Studentenwerk hat Anfang der 90er Jahre die ersten Wohngemeinschaften eingerichtet. Andernorts begannen die Studentenwerke schon in den 70er Jahren mit dem Bau von Wohnheimen mit WGs. Heute wird bundesweit fast die Hälfte der 185000 Wohnheimplätze in Wohngruppen angeboten, darunter sind jedoch auch Familienwohnungen.
Die Unterkünfte sind sehr gefragt, obgleich die Wohngemeinschaften des Studentenwerks einen entscheidenden Nachteil haben: Die Kommunarden können sich ihre Mitbewohner in der Regel nicht selbst aussuchen.
Literaturstudentin Sabina Neuling aus der WG im Adolf-Reichwein-Haus sieht darin kein Problem. Im Gegenteil. Die 22-Jährige hat selbst ein paar "WG-Castings" hinter sich. Angenehm seien die Gespräche oft nicht, so Neuling: "Vielleicht klappt es bei uns so gut, gerade weil wir so bunt zusammengemischt wurden", sagt sie: "Wenn man vorher lange miteinander befreundet ist, hat man oft einen großen Druck dahinter." Manchmal macht das Studentenwerk aber auch Ausnahmen wie bei Margarita Kotseva: Sie wechselte von einem Wohnheim-Einzelzimmer in die Frauen-WG, die sie gern als Mitbewohnerin haben wollte.
In der 5er-WG sind auf diese Weise außergewöhnliche Studentinnen zusammengekommen: Die aus Südchina stammende Amerikanistikstudentin Xiaohua Zhuang trägt auch im Alltag fast immerKleider aus ihrer Heimat, ebenso wie die Molekularbiologiestudentin Nazesh Bhatti mit ihren farbenprächtigen, pakistanischen Gewändern. "Daneben fühlt man sich immer underdressed", sagt Sabina Neuling.
Xiaohua Zhuang ist begeistert von ihrem Zwölf-Quadratmeter-Zimmer in der WG: "Das habe ich nicht erwartet", sagt die Amerikanistikstudentin. In ihrer Heimat wohnen die Studierenden in Mehrbettzimmern ohne Küche. Von ihrem Zimmer in Marburg gibt es sogar einen Zugang zum Balkon, auf dem sich die Studentinnen im Sommer mit Schlossblick sonnen können. Als Xiaohua Zhuang vor eineinhalb Jahren nach Marburg kam, konnte sie kein Wort Deutsch. Inzwischen spricht sie die Sprache fließend. "Das habe ich von den Mädels gelernt", sagt sie über ihre Mitbewohnerinnen. Und die WG ist natürlich auch Familienersatz.
Treffpunkt der Frauen im Adolf-Reichwein-Haus ist die geräumige Küche, in der sich WG-Bär Balu auf dem Sofa unter den Fotos der Bewohnerinnen lümmelt. Fast jede Woche gibt es Gemüse-Curry aus der Nazesh Bhattis pakistanischer Heimat. Beim Kochen sind die Fünf ein eingespieltes Team. Jede schnippelt, so dass Tomaten, Pilze, Paprika, Zwiebeln und Gurken nach wenigen Minuten im Topf landen. Dazu gibt es Brot aus Haferflocken, Mehl, Wasser und Öl. "Pakistanisch essen wir inzwischen am liebsten", sagt Laureen Mieth. Aber auch Gerichte mit Schafskäse, den sich Margarita Kotseva eigens aus Bulgarien schicken lässt, gibt es häufig. Und Xiaohua Zhuang steuert gern einen chinesischen Nachtisch bei, mit Schokolade gefüllte, warme Teilchen, danach den traditionellen Chai-Tee.
Eine Haushaltskasse brauchen sie dafür nicht. Auch ein Putzplan ist nicht nötig. Obgleich es keine Spülmaschine gibt, türmen sich keine Geschirrberge in der Küche. Bei ihnen ist es so ordentlich, dass die Putzfrauen des Studentenwerks, die einmal pro Woche in die Küche kommen, kaum etwas zu tun haben. Wenn jemand einmal etwas mehr für die Uni arbeiten muss, übernehmen die Mitbewohnerinnen das Spülen und Kochen. Wenn Nazesh Bhatti betet, halten die anderen selbstverständlich Ruhe. Schließlich mögen sie sich, gehen gemeinsam shoppen, quatschen am Küchentisch und treffen sich zu "Mädelsabenden"."Wenn die Chemie zwischen den Bewohnern stimmt, schafft das eine tolle Atmosphäre", sagt Studentenwerkschef Uwe Grebe. Wenn es Ärger um dreckiges Geschirr oder schmutzige Bäder gebe, könne es auch schwierig werden.
Entscheidend für die WG-Bewohnerinnen ist allerdings auch die niedrige Miete: 181 Euro zahlen sie für ihre mit Waschbecken ausgestatteten Zwölf-Quadratmeter-Zimmer mit eingerichteter Gemeinschaftsküche und gemeinsamem Balkon. Als sie auf dem freien Markt suchten, sollten die WG-Zimmer zwischen 300 und 500 Euro kosten – wenn überhaupt Zimmer frei waren.
Höhere Kosten können sich die Frauen aber kaum erlauben. Fast alle jobben nebenher: Margarita hat sogar mehrere Jobs – an einer Tankstelle, beim Forstamt, in einem Imbiss und auf dem Weihnachtsmarkt. Aber auch die anderen arbeiten als Babysitter, Übersetzer und Servicekräfte.
Im engen Marburger Zentrum gibt es weder erschwingliche Wohnungen noch genug Wohnheimplätze. Jeden Herbst müssen in den Kellern und auf den Dachterrassen des Marburger Studentendorfs Notunterkünfte eingerichtet werden. Noch verschärft hat sich die Situation durch den Brand des größten Marburger Studierendenwohnheims im Juni vergangenen Jahres, als 280 Menschen von der Feuerwehr gerettet werden mussten, 23 wurden verletzt. Betroffen waren vor allem Familien, die bis heute nicht zurückziehen konnten."Das hat unsere Planungen über den Haufen geworfen", sagt Studentenwerkschef Grebe.
Dabei hatte sich das Marburger Studentenwerk gefreut, 2014 drei neue Studentenwohnheime eröffnen zu können: Ein mit Unterstützung des Denkmalschutzes und der Stadt sanierter Altbau in der Oberstadt, in dem nun 34 Studierende wohnen, das Max Kade Wohnheim im Studentendorf mit 49 Plätzen sowie eine angemietete Etage eines Seniorenzentrums mit 16 Einzelappartements. Und es sind weitere Häuser in Planung: Am ehemaligen Arbeitsgericht im Zentrum Marburgs soll noch in diesem Jahr mit dem auf 3,8 Millionen Euro veranschlagten Bau eines neuen Studentenwohnheims mit 60 Plätzen und kleinem Bistro begonnen werden. Auch neben dem Studentendorf ist ein weiteres Wohnheim geplant. Klar ist jedenfalls, so Grebe: "Im Moment ist es wirklich eng. Preisgünstige, zentrale Wohnungen fehlen insgesamt."
Arbeitsverbot völlig überholt
 Kreis-Sozialdezernent will qualifizierten Flüchtlingen den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichten – Foto: Kreis Gießen
Kreis-Sozialdezernent will qualifizierten Flüchtlingen den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichten – Foto: Kreis Gießen
"Flüchtlinge können wir am besten gesellschaftlich integrieren, wenn wir ihnen die Möglichkeit zu arbeiten geben", sagt Dirk Oßwald. Der Sozialdezernent des Landkreises unterstützt den Vorstoß von Arbeitgebern und der Arbeitsagentur. Sie fordern: Flüchtlingen soll der Weg zu einer "Blue Card" und damit in den deutschen Arbeitsmarkt vereinfacht werden. Dabei befürwortet Dirk Oßwald nicht nur diese Forderung, er geht noch einen Schritt weiter. Er fordert bundesweit verstärkte Praktikumsmöglichkeiten für Flüchtlinge, wie es das Pilotprojekt "Integration Move" des Landkreises ermöglicht.
Immer mehr Flüchtlinge kommen nach Deutschland. Oftmals bringen sie Fachwissen mit. Doch arbeiten dürfen sie zunächst nicht. Drei Monate müssen sie grundsätzlich warten. "Das 15-monatige Arbeitsverbot danach ist völlig überholt, zumal 60 Prozent dieser Migranten qualifizierte Berufsabschlüsse haben", sagt Dirk Oßwald. Der Bedarf an Arbeitskräften ist vorhanden: Krankenpfleger, Ärzte, Ingenieure, Facharbeiter. Und er wird in den kommenden Jahren noch massiv steigen. Das sagen Arbeitsmarktforscher wegen der alternden Bevölkerung vorher. "Der demografische Wandel der kommenden Jahren kann ansonsten nicht bewältigt werden."
Dirk Oßwald unterstützt grundsätzlich die Forderung von Arbeitgebern und der Bundesagentur für Arbeit, Flüchtlinge leichter in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Allerdings möchte er dies nicht nur auf die sogenannte "Blue Card" beschränken. Die können Ausländer eines Nicht-EU Landes beantragen, die zum einen über einen deutschen oder einen anerkannten ausländischen oder einen dem deutschen vergleichbaren ausländischen Hochschulabschluss verfügen. Außerdem müssen sie einen Arbeitsvertrag mit einem Bruttojahresgehalt in Höhe von mindestens 48.400 Euro oder in sogenannten Mangelberufen (Naturwissenschaftler, Mathematiker, Ärzte etc.) in Höhe von 37.752 Euro haben.
"So wie die 'Blue Card' aktuell angelegt ist, können nur sehr wenige Flüchtlinge diese Möglichkeit nutzen", sagt Dirk Oßwald "denn die Höhe des Einkommens ist als Einstiegsgehalt kaum zu erreichen." Seiner Meinung nach sollte nicht nur die Einkommenshöhe von mindestens 48.400 Euro brutto jährlich deutlich heruntergesetzt werden. Der Sozialdezernent des Landkreises geht noch einen Schritt weiter. Er spricht sich für einen Richtungswechsel in der Flüchtlingspolitik aus: weg vom Asyl- und hin zum Visumverfahren. Genau, wie dies auch Raimund Becker, Vorstand der Bundesagentur für Arbeit, kürzlich gefordert hat.
Was heißt das aber konkret? Aktuell haben Flüchtlinge nur einen sogenannte nachrangigen Arbeitsmarktzugang. Das bedeutet, sie haben erst dann die Perspektive auf eine Arbeit, wenn kein Deutscher, kein EU-Bürger und kein Vorrangiger aus Drittstaaten den Job will. "Dagegen ist im Prinzip nichts einzuwenden, in der Praxis bedeutet das aber: Bewirbt sich ein Flüchtling hier innerhalb der ersten eineinhalb Jahre auf eine Stelle und wird ausgewählt, muss er dennoch eine Vorrangprüfung durchlaufen."
Die Folge: Die Anstellung verzögert sich erheblich und die Chancen auf eine Einstellung sinken erheblich. "Deshalb ist es sinnvoll, wenn wir einem Menschen, der eine Chance auf Integration hat, einen Spurwechsel ermöglichen und ihn oder sie aus dem Asylverfahren herausnehmen", sagt Dirk Oßwald. Dies müsse auch und insbesondere für jugendliche Flüchtlinge gelten, die eine Ausbildungsstelle erhalten. "Sie sollten für diese Zeit und die zwei Jahre danach ebenfalls das Aufenthaltsrecht erhalten", so Dirk Oßwald.
Wie schnell der Kontakt zwischen Flüchtlingen und Arbeitsmarkt geknüpft werden kann, zeigt aktuell das Projekt "Integration Move". Der Landkreis Gießen betreut aktuell 1568 Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften in den Städten und Gemeinden. Seit März haben diese die Möglichkeit für ein maximal sechswöchiges Praktikum oder eine zweimonatige Arbeitsgelegenheit. "Das Projekt ist eine Erfolgsgeschichte", sagt Dirk Oßwald. Dahinter steckt die Erkenntnis: "Die Menschen bringen aus ihren Heimatländern Fähigkeiten und Berufsabschlüsse mit – das müssen wir nutzen."
"Move" steht für "Migranten optimal vorbereiten für die Erwerbstätigkeit". Wie funktioniert das? Im Auftrag des Landkreises besucht Britta Strauch von der Zaug gGmbH die Flüchtlinge in den Gemeinschaftsunterkünften und berät sie. Ziel ist es, Praktika und Arbeitsgelegenheiten zu vermitteln. Letztere sind auch besser bekannt als Ein-Euro-Jobs. Die dauern im Durchschnitt zwei Monate.
Die Flüchtlinge helfen 20 Stunden in der Woche in staatlichen, kommunalen oder gemeinnützigen Institutionen des Landkreises. Warum nicht mehr? Dies ist einerseits gesetzlich geregelt. Andererseits sollen im Falle eines Praktikums laufende Deutschkurse weiterhin besucht werden können. "Unter den rund 60 Prozent der im Landkreis lebenden Flüchtlinge im erwerbsfähigen Alter mit einer beruflichen Qualifikation sind viele Berufe, die wir brauchen." Stichwort: Fachkräftemangel.
Nach nur fünf Monaten "Intagration Move" haben bis jetzt 35 Flüchtlinge ein Praktikum gemacht und 16 eine Arbeitsgelegenheit angenommen. Praktika fanden bislang unter anderem in einem Restaurant, einer Gemeinde, im Garten- u. Landschaftsbau, in einem landwirtschaftlichen Betrieb sowie in einer evangelischen Kirchengemeinde statt. "Die Reaktionen sind durchweg positiv, es gibt nicht eine negative Rückmeldung, sowohl von den Arbeitgebern als auch den Flüchtlingen", sagt Dirk Oßwald.
Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein

Guardians of the Galaxy